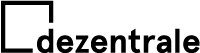صباحا 11. و 12. Mai sind die internationalen Awareness-Tage für ME/CFS. Sie sollen Aufmerksamkeit auf eine Krankheit legen, die meist unsichtbar bleibt und gegen die doch in Deutschland hunderttausende Menschen einen täglichen Kampf führen. Wir haben mit einer Betroffenen darüber gesprochen wie man mit ME/CFS weiterlebt und dabei nicht nur auf die eigenen, sondern die Grenzen dieser Gesellschaft stößt.
Was ist ME/CFS für eine Krankheit?
ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom) ist eine schwere chronische neuroimmunologische Erkrankung. Sie führt zu einer tiefgreifenden Erschöpfung, die nicht durch Schlaf oder Ruhe besser wird, und zu vielen weiteren Symptomen: Schmerzen, Kreislaufprobleme, Reizempfindlichkeit und kognitive Einschränkungen (verringerte Merk-, Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit). Der Haubtauslöser ist meißtens eine Virusinfektion wie Pfeiffersches Drüsenfieber, Influenza oder Covid. Betroffen sind in Deutschland (يفهم 2023) 620.000 الناس. Die Dunkelziffer dürfte aufgrund von fehlenden Diagnosen deutlich höher liegen.
Was bedeutet es für Menschen von der Krankheit betroffen zu sein?
Es heißt nicht einfach müde zu sein. Die Erschöpfung ist bei ME/CFS so tiefgreifend, dass sie mit „normaler Müdigkeit“ oder der Erschöpfung während und nach einem Infekt nicht vergleichbar ist. Die Symptome und deren Schweregrad bei ME/CFS variieren stark von Person zu Person. Schon bei einem milden Verlauf ist das Aktivitätsniveau auf etwa 50 % reduziert – das bedeutet, dass Betroffene vielleicht noch Teilzeit arbeiten können, sich jedoch in der übrigen Zeit ausruhen müssen und sich dabei häufig schlecht fühlen. Moderat Erkrankte können das Haus nur noch selten verlassen – oft nur mit Rollstuhl oder Rollator. Schwerbetroffene sind dauerhaft bettlägerig und kaum mehr in der Lage, Reize wie Licht oder Geräusche zu ertragen. ME/CFS betrifft alle Lebensbereiche und kann zu einem hohen Grad an Behinderung führen – bis hin zur völligen Pflegebedürftigkeit. Insofern ist die Bezeichnung „Fatigue-Syndrom“ auch irreführend – sie wird der Schwere der Erkrankung nicht gerecht.
Wie beeinträchtigt dich ME/CFS persönlich?
ME/CFS beeinträchtigt mich in allen Lebensbereichen. Ich kann mein früheres Leben nicht mehr führen. Immer wieder bin ich für Tage ans Bett gefesselt – mit Schmerzen, starker Reizempfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und Berührung. Dann bleibt mir nichts, außer still im Dunkeln zu liegen und zu hoffen, dass es irgendwann besser wird.
Es gibt auch Tage, an denen es mir etwas besser geht. Aber weil ich jung bin und meine Krankheit nicht immer sichtbar ist, begegnet mir viel Unverständnis. Ich habe oft das Gefühl, dass mir nicht geglaubt wird – dass andere nicht nachvollziehen können, wie krank ich wirklich bin, weil ich an manchen Tagen „normal“ aussehe. Die schlimmsten Momente meiner Erkrankung bekommt niemand mit, weil ich dann zu schwach bin, um überhaupt um Hilfe zu bitten. Diese Unsichtbarkeit macht es so schwer, Aufmerksamkeit für die Krankheit zu bekommen.
Was für einen Einfluss hatte die Situation auf deine Beziehungen? Was für Erfahrungen machst du mit ME/CFS in deinem Umfeld?
Meine Freundschaften haben sich stark verändert. Ich bin immer abhängiger geworden – gleichzeitig fällt es mir extrem schwer, um Hilfe zu bitten. Ich stecke noch tief in dieser Logik fest: „Man sollte nur nehmen, wenn man auch geben kann.“ Die Vorstellung, dass andere einfach nur für mich da sind, fühlt sich für mich fast unerträglich an. Und ich glaube, nicht nur ich denke so – auch Teile meines Umfelds.
Ich bin heute deutlich weniger leistungsfähig als früher – und in einer Gesellschaft, die stark von Leistungsdenken geprägt ist, ist das unglaublich hart. Es fühlt sich demütigend an, und dieses Gefühl, „nicht genug zu sein“, begleitet mich permanent. Wer nicht (mehr) vollständig leistungsfähig ist, wird oft nicht nur alleine gelassen, sondern regelrecht abgewertet. Ich muss mich ständig rechtfertigen – gegenüber Ärzt*innen, سلطات, im persönlichen Umfeld. Immer wieder wird mir unterstellt, ich übertreibe, bilde mir etwas ein oder sei einfach psychisch labil. Diese Haltung erinnert mich stark an das alte, patriarchale Bild der „hysterischen Frau“ – ein Bild, das sich bis heute hält, vor allem bei Erkrankungen, die überwiegend Frauen betreffen. Dreiviertel der von ME/CFS Betroffenen sind laut Studien Frauen (wobei in den Studien die Geschlechter nur binär erfasst worden sind)
An welchen Hürden stößt du im Gesundheitssystem?
Ich stoße auf Hürden an so vielen Stellen – bei Ärzt*innen, سلطات, Versorgungseinrichtungen. Ich suche seit Jahren nach Behandlungsmöglichkeiten, aber ich muss mir alles selbst zusammensuchen. Für eine Krankheit, die auch das Denken und Planen massiv einschränkt, ist das wahnsinnig belastend. Und ich bin noch moderat betroffen – ich will mir gar nicht ausmalen, wie es den schwerer Erkrankten geht. Die werden praktisch völlig unsichtbar.
Wie ist aktuell die Versorgungslage für Menschen, die von ME/CFS betroffen sind?
Die medizinische Versorgung ist fragmentiert. Es gibt kaum Zusammenarbeit zwischen den Fachrichtungen. Auf meine Reha warte ich seit über zwei Jahren – erst wurde sie mehrfach abgelehnt, dann habe ich ein Jahr auf einen Platz gewartet. Mein Antrag auf einen Fahrdienst für den Arbeitsweg wurde abgelehnt, weil ich „zu krank zum Arbeiten“ bin. Für eine Einstufung als Schwerbehinderte bin ich aber angeblich zu gesund. Diese Widersprüche machen nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass Behörden möglichst wenig zahlen wollen. Zuständigkeiten werden hin und her geschoben – als wolle man uns „beschäftigen“, statt zu helfen.
Und dann ist da die soziale Schieflage: Ich habe große Angst davor, irgendwann vollständig arbeitsunfähig zu sein – weil ich mir dann viele Behandlungen, Medikamente oder Hilfen einfach nicht mehr leisten könnte. Oft werden einem zig Behandlungen empfohlen, aber alle sind Selbstzahlerleistungen. Wer kein Geld hat, hat keine Chance. Solange man noch als Arbeitskraft funktioniert, bewegt sich vielleicht noch etwas. Aber sobald man „zu viel“ krank ist, wird man abgeschrieben oder wirtschaftlich kaputt gemacht.
Du hast die soziale Schieflage angesprochen, die Stigmatisierung von Frauen mit ME/CFS – der gesellschaftliche Umgang mit der Krankheit betrifft Kernthemen der Linken. Wie erlebst du dort den Umgang mit ME/CFS?
Auch in linken Kontexten, wo man eigentlich andere Maßstäbe leben möchte, sieht es in der Frage der Leistungslogik oft nicht grundlegend anders aus als in der restlichen Gesellschaft. Zwar wird dort Leistung nicht immer über Lohnarbeit definiert, aber der Wert eines Menschen misst sich auch hier häufig an seiner Beteiligung: an Demos, an Plena, an der Organisation von Veranstaltungen. Anerkennung hängt zu oft an Aktivismus, und wer daran nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen kann, bleibt schnell außen vor. Care-Arbeit ist auch in diesen Räumen ungleich verteilt, und das Bewusstsein dafür, wie viel Verantwortung in familiären oder partnerschaftlichen Beziehungen hängen bleibt, fehlt häufig. Es mangelt an einem kollektiven Verständnis dafür, dass Sorgearbeit in unseren Kämpfen nicht nur mitgedacht, sondern strukturell anders organisiert werden muss – auch jenseits klassischer Arbeitsverhältnisse.
Menschen mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf werden in dieser Gesellschaft, die so sehr auf Selbstoptimierung und Produktivität ausgerichtet ist, systematisch benachteiligt. Statt Solidarität erfahren sie Misstrauen und das Gefühl eine Last zu sein. Die gesellschaftliche Struktur zwingt sie dazu, ihre Bedürftigkeit zu erklären und zu verteidigen – immer und immer wieder.
Was macht dich wütend?
Ich bin wütend, weil ich nicht ernst genommen werde. Ich finde oft keinen Ausdruck für diese Wut – und wenn doch, dann trifft sie die Falschen. Ich fühle mich allein gelassen. Und ich bin wütend auf dieses patriarchale, kapitalistische System, das mir immer wieder das Gefühl gibt, ich sei eine „kleine, jammernde Frau“, die sich einfach mal zusammenreißen soll. Wenn man nicht funktioniert, ist man in dieser Gesellschaft nichts wert. Das spüre ich jeden Tag.
Ich brauche dringend bessere medizinische Versorgung, passende Medikamente, die Anerkennung von ME/CFS als chronische Krankheit und Behinderung. Ich brauche aber auch ein gesellschaftliches Umdenken: in Bezug auf Care-Arbeit, auf Solidarität, auf gegenseitige Verantwortung. Wir brauchen ein System, in dem nicht „der*die Stärkste gewinnt“, sondern in dem wir uns umeinander kümmern.
Was wünschst du dir? ماذا تحتاج?
Ich wünsche mir, dass Menschen wirklich zuhören. Dass sie nicht vorschnell urteilen, sondern versuchen zu verstehen. Ich wünsche mir Anerkennung, Unterstützung, Teilhabe – und eine Gesellschaft, die Schwäche nicht als Makel sieht, sondern als Teil des Menschseins.
Ich brauche medizinische Hilfe für alle, ohne kämpfen zu müssen. Ich brauche finanzielle Sicherheit für alle, ohne Angst vor dem völligen Absturz. Ich brauche Räume, in denen ich mich zeigen darf, wie ich bin – krank, verletzlich, wütend, مرهق. Und ich brauche Menschen, die bleiben, auch wenn ich nichts „leisten“ kann.